Kaminöfen - Dreckig, umwelt- und gesundheitsschädlich
Kaminöfen - Die ignorierte Umweltsauerei
Man bewohnt ein Haus in einer ländlichen Gegend und erfreut sich an der schönen Natur unmittelbar vor der Haustür. Keine nennenswerte Verkehrsbelastung mit Lärm und Abgasen. Doch immer öfter wird die Freude getrübt, da die Luftqualität in unserer Reihenhaus- und Einfamilienhaussiedlung im Winter immer häufiger schlechter ist, als an einer stark befahrenen Straße in der Stadt. Das Problem: Holzrauchgase und Feinstaub, die in großen Mengen von privat betriebenen Holzfeuerstätten (hauptsächlich Kaminöfen für Scheitholzverbrennung) ausgestoßen werden. Die Werte sind teilweise so hoch, dass der nahegelegene vielzitierte Osnabrücker Neumarkt dagegen ein Luftkurort ist. Häufig wissen die Betreiber solcher Öfen nicht, welche Luftverschmutzung sie (drinnen und draußen) verursachen, manchen ist es egal oder sie wollen es nicht wahrhaben und setzen sich nicht objektiv mit dem Problem auseinander. Man kann sich z.B. mit diesem Beitrag zum Thema informieren. Auch das Umweltbundesamt äußert sich mittlerweile sehr kritisch zu Kaminöfen.
Die Kaminöfen werden üblicherweise als "Komfortöfen" betrieben, also zusätzlich zu einer wesentlich emissionsärmeren Gas- oder Ölheizung. Ein Grund hierfür ist wohl der vermeindliche Wohlfühlaspekt der angeblich "angenehmeren Wärme". Vielleicht spielt auch die Selbstwirksamkeit des Kaminofenbesitzers eine Rolle:“Ich mache selber Holz und dann verbrenne ich es.“ Wirtschaftliche Überlegungen spielen kaum eine Rolle, denn das Einsparpotenzial gegenüber einer Gas- oder Ölheizung ist bestenfalls gering. Außerdem zählen die Einwohner der betreffenden Gegenden meist nicht zu den sozial Schwachen. So holt sich die Mittelschicht in den Einfamilienhaussiedlungen die Luftproblematik, die zur Zeiten der Industrialisierung eher die Armen Leute betraf und durch die flächendeckende Einführung von Zentralheizungen überwunden wurde, durch ein Lifestyle-Gadget wieder vor die eigene Haustür und ins Haus (vgl. Beitrag von Jörg Kachelmann). Da Feinstaubmessungen von behördlicher Seite hauptsächlich an Hauptverkehrsstraßen in Städten durchgeführt werden ist das Feinstaubproblem in Wohnsiedlungen außerhalb der Innenstädte bisher kaum in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Bis vor kurzem war mir dieses Problem auch noch nicht so deutlich bewusst - bis auf zeitweilige (z.T. erhebliche) Geruchsbelästigung habe ich es weitgehend ignoriert. Doch die zunehmende Diskussion um Feinstaubbelastung durch den (Diesel)Autoverkehr hat mich neugierig gemacht. Relativ schnell stößt man dann auf aktuelle Untersuchungen, die darlegen, dass die durch Holzverfeuerung emittierte Feinstaubmenge in Deutschland mittlerweile größer ist, als die des gesamten Autoverkehrs (s. z.B. hier) und dass der freigesetzte Feinstaub erhebliche gesundheitliche Risiken birgt (s. z.B. hier). Vor dem Hintergrund solcher Fakten kommt eine Anschaffung eines Kaminofens für uns keinesfalls mehr in Frage - natürlich auch im eigenen Interesse, da die Innenraumluftbelastung durch Kaminöfen erheblich ist. Aber das Kind ist längst in den Brunnen gefallen. Ein im Garten installierter Feinstaubsensor (Werte hier einsehbar) dokumentiert tagtäglich die (winterliche) Luftbelastung (der Sensor kann von Jedermann für wenig Geld zur Messung der Luftbelastung eingesetzt werden - hier findet man die Anleitung dazu). Die Messwerte des eingesetzten Sensors sind bei hoher Luftfeuchtigkeit leider nicht sehr genau und für amtliche Messungen ungeeignet. Eine qualitative Aussage über die Feinstaubbelastung ist aber gut möglich. Bei der Anfeuerung eines Kamins ensteht besonders viel Feinstaub - häufig an einem deutlichen Peak, vor allem am Abend gegen 17.00-18.00Uhr, ablesbar. Da kommt der Herr des Hauses zurück und feuert wie in alten Zeiten für die Familie an. Auch am Morgen ist dies zwischen 6.00 und 8.00 Uhr häufig zu beobachten. Am Wochenende wird häufig durchgehend geheizt, die Werte gehen bei austauscharmen Wetterlagen kaum zurück. Auch in der Nacht, wenn der Ofen langsam ausschmurgelt, wird vermehrt Feinstaub ausgestoßen und die nach der Anfeuerung erhöhten Werte gehen nur langsam zurück oder steigen sogar noch an, es sei denn, es bläst ein ordentliches Lüftchen. Man hofft mittlerweile schon auf Wind und Regen, damit der Dreck sich "aus dem Staub macht".
Die durch Feinstaub verursachten Erkrankungen der Lunge, Atemwege und des Herz-Kreislaufsystems werden in Zukunft sicherlich weiter zunehmen. Hier ist die Politik gefordert, die leider die Holzverfeuerung im Rahmen der CO2-Problematik befürwortet und sogar (Gott sei Dank nicht bei Kaminöfen) fördert und das durch Kaminöfen verursachte Feinstaubproblem weitgehend ignoriert. Dabei gibt sogar das Umweltbundesamt an, dass ein Kaminofen in einer Stunde Betrieb mindestens so viel Feinstaub ausstößt, wie ein Auto auf 100km (https://www.umweltbundesamt.de/themen/heizen-holz). Die aktuellen Typprüfungen für Kaminöfen sind offensichtlich nur eine Farce und im Kern ein ähnlich flächendeckender Betrug wie vor kurzem die Tricksereien der Autohersteller bei den Typzulassungen für Dieselmotoren. Der Schadstoffausstoß der Öfen wird unter Idealbedingungen (optimales Brennmaterial, optimale Holzmenge, Messungen ohne Anheiz- und Ausbrennphase usw.) ermittelt, welche in normalen Betrieb nicht zu erreichen sind. Hier liegt der Schadstoffausstoß dann um ein Vielfaches höher, auch weil die möglichst schadstoffarme Holzfeuerung mit Kaminöfen, die zumindest das Allerschlimmste verhindern würde, recht kompliziert ist. Hier folgt nach "Dieselgate" nun "Holzofengate". Der Normalbetreiber scheint überfordert. Korrektes Anheizen, korrekte Regelung der Primär- und Sekundärluft, korrektes Nachlegen von Scheitholz ist kompliziert und lästig, da lässt man den Ofen doch lieber in Ruhe und schmeißt ab und zu etwas Brennmaterial nach. Ein weiterer häufiger Fehler ist die zu frühe Abregulierung der Luftzufuhr, z.B. weil es im Zimmer zu warm wird oder weil der Kaminofenbetreiber eine längere Brennzeit erreichen möchte. Durch die so provozierte unvollständige Verbrennung werden besonders viele Emissionen erzeugt. Neben dem Feinstaub auch Ruß und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die als krebserregend gelten. Die Infoseiten zum richtigen Heizen mit Holz laufen häufig ins Leere. Einige Kaminofenbesitzer unterliegen leider zudem der Versuchung bearbeitetes Holz, Papier, Pappe oder sogar Müll zu verbrennen. Regelmäßig zu beobachten, wenn grauer oder (tief)schwarzer Rauch aus den Schloten quillt und ein deutlich wahrnehmbarer, z.T. beißender, Geruch in der Luft hängt. Eine flächendeckende Überwachung der einzuhaltenden Grenzwerte und des ordnungsgemäßen Betriebes der Feuerstätten ist kaum möglich. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Studien und Untersuchungen zu Schadstoffemissionen, insbesondere Feinstäuben, bei Kaminöfen sind eindeutig und müssten eigentlich sofort zu weitgehenden Verboten bei der privaten Holzfeuerung führen. Die deutsche Politik reagiert bisher nur zögerlich und keinesfalls ausreichend auf die Ergebnisse. Erforderliche Maßnahmen werden wohl erst folgen, wenn Klagen von Umweltschutzorganisationen auf den Weg gebracht werden oder weitere Strafverfahren der EU drohen.
Die angebliche Klimaneutralität von Holz als Brennstoff hält einer genaueren Betrachtung nicht stand, denn ein Baum, der viele Jahrzehnte gewachsen ist und weiterhin als CO2-Speicher dienen könnte, wird in wenigen Tagen verfeuert. Dabei wird das gesamte gespeicherte CO2 in kurzer Zeit freigesetzt. Verrottet ein Baum im Wald, dient er dort dem Ökosystem in vielfältiger Weise und ein Teil des CO2 wird z.B. für die Bildung von Humus umgesetzt. Da Öl und Gas stärker komprimierte Brennstoffe sind, entsteht hier bei gleichem Heizwert deutlich weniger CO2 bei der Verbrennung. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz erklärt die nicht gegebene Klimaneutralität beim Heizen mit Holz mit verständlichen Worten:
"Heizen mit Holz ist entgegen der weit verbreiteten Meinung nicht klimaneutral. Die Holzverbrennung produziert neben Feinstaubemissionen auch CO2- und andere klimarelevante Emissionen wie Methan. Pro produzierter Wärmeeinheit sind die CO2-Emissionen sogar höher als bei fossilen Energieträgern wie Kohle oder Gas.
Der Idee einer klimaneutralen Energie, die aus Holz gewonnen wird, liegt der Gedanke einer nachhaltigen Waldnutzung zugrunde: Die Vorstellung ist, dass die CO2-Emissionen aus der Verbrennung durch die jährlichen Einbindungen von Kohlenstoff in Waldholz insgesamt ausgeglichen werden. Hierbei wird die vereinfachende Annahme getroffen, dass die durch den Wald erfolgenden Kohlenstoff-Einbindungen zum Ausgleich der CO2-Emissionen der Holzverbrennung zur Verfügung stehen. Diese Kohlenstoff-Einbindungen finden aber unabhängig von der Holzverbrennung statt und sollten besser zum Ausgleich anderer, nicht vermeidbarer CO2-Emissionen genutzt werden."
Wird die energetische Nutzung von Holz nicht gestoppt oder zumindest reduziert, werden zudem immer mehr (auch naturnahe) Wälder abgeholzt. Jetzt schon in erschreckender Form in einigen Regionen Osteuropas zu beobachten. Dass Bäume nachwachsen können, hat mit den hohen Emissionen der Holzverbrennung nichts zu tun, wird aber von der Holzlobby immer in einen unzulässigen Zusammenhang eines angeblichen CO2-Kreislaufes gebracht. Zudem: Ein Baum kann zwar (in Jahrzehnten) nachwachsen, das komplexe Ökosystem Wald erholt sich von massiven Eingriffen jedoch kaum. Aufforstung und Renaturierung von Wäldern ist eine schwierige und langwierige Aufgabe mit ungewissen Erfolgsaussichten. Um den Bewirtschaftungsdruck auf Wälder zu reduzieren, sollte die energetische Nutzung von Holz sofort eingestellt werden.
Einziger Trost und kleine Hoffnung: Da die Betreiber von Kaminöfen durch belastete Außenluft und zusätzlich stark belastete Innenraumluft im eigenen Haus am stärksten von der selbst verursachten Luftverschmutzung betroffen sind (besonders für Kinder und vorbelastete Personen ist die belastete Luft problematisch), findet in nächster Zeit hoffentlich ein Umdenken statt und die Öfen werden weniger genutzt oder sogar ganz aufgegeben. Dies wäre sicherlich der Fall, wenn die Besitzer sich objektiv über ihren Kaminofen informieren würden und z.B. während des Betriebes ihrer Kaminöfen Innenraumluftmessungen durchführen würden (s. z.B. hier oder hier). Die Belastungen in der Raumluft erreichen Werte, die denen beim Rauchen nahe kommen - und das dauerhaft. Es ist kaum zu verstehen, wie die Holzverbrenner diesen ständigen Brandgeruch im eigenen Haus aushalten und auch noch stolz auf die steinzeitliche Heizstätte sind. Oft bin ich bei Kaminofenbesitzern in stark überheizte Räume mit schlechter Luftqualität gekommen. Da lob ich mir die angenehme Wärme unserer gasbetriebenen Fußbodenheizung. Aber die Öfen sind ja sooo gemütlich. Hilfe, es ist Mitte September und es stinkt. Sie heizen wieder an, sie heizen wieder an...
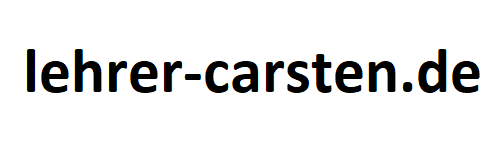

Einen Kommentar schreiben
Kommentar von Peter Schwettmann |
Guten Tag, eine schöner Artikel, der das ganze Elend der Holzverbrennung aufzeigt.